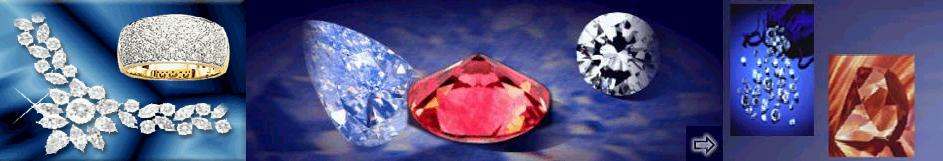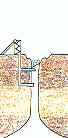Mag
die Entstehung der Diamanten noch
weitgehend im Dunkeln liegen, so weiß man doch eines sehr genau,
wo sie auf der Erdoberfläche vorkommen: in Kimberlit, einem Gestein,
das nach der südafrikanischen Stadt Kimberley benannt ist, wo
es im Jahre 1880 erstmals bestimmt wurde.
Kimberlit
ist das heterogene Produkt einer chaotischen Entstehungsgeschichte,
denn bei ihm handelt es sich um das Gestein, das explosionsartig
durch die Pipes aus dem Erdmantel nach oben befördert wurde. Neben
erstarrtem Magma unterschiedlicher Zusammensetzung enthält Kimberlit
Gesteinsfragmente, die er auf seiner vehementen Reise mitgerissen
hat.
Lagerstätten von diamantführendem Kimberlit, die man in
Afrika, Brasilien, Indien, Australien, Nordamerika und Sibirien
gefunden hat, kommen nur in den ältesten und stabilsten kontinentalen
Gebieten vor, weit weg von den unruhigen Zonen, in denen die starren
Platten, aus denen die Erdkruste besteht, sich voneinander entfernen,
aneinander entlangschrammen oder zusammenstoßen. Die Kruste ist
unter diesen alten, ungestörten kontinentalen Plattenteilen, den
sogenannten Schilden, am dicksten, und ihr Gewicht erzeugt Drücke,
die hoch genug sind, um in den oberen Bereichen des Mantels -
dem Herkunftsort des Kimberlit - Diamanten entstehen zu lassen.
Viele Kimberlit-Vorkommen wurden vor 70 bis 150 Millionen Jahren
gebildet; es wurden allerdings auch solche gefunden, die bis zu
1,2 Milliarden Jahre alt sind.
Weil
das Kimberlit wahrscheinlich große Mengen festen Gesteins enthielt,
schoß es nicht wie flüssige Lava aus den Spalten in der Erdoberfläche.
Vielmehr führte der Druck des aufsteigenden Magmas wahrscheinlich
dazu, daß sich das Oberflächengestein nach oben wölbte und dann
im Zentrum zusammenbrach, als die das Kimberlit treibenden Gase
entwichen waren. In dem so entstandenen Krater erstarrte es zu
einer Gesteinsablagerung mit einem Durchmesser von einigen hundert
Metern bis 1,5 Kilometern. Hier waren die primären Vorkommen von
Diamanten entstanden, d.h. die Diamanten befinden sich an dem
Ort, an dem sie ursprünglich an die Erdoberfläche gelangten (Ggs.:
sekundäres Vorkommen).
Wie
jede andere Gesteinsart auf der Erdoberfläche wurden auch diese
Krater von Wasser, Wind, Eis oder Chemikalien in der Atmosphäre
angegriffen. Dadurch werden sie abgeflacht und abgetragen, und
es entsteht der sog. yellow ground (engl.: gelbe Erde). Dabei
handelt es sich um den durch o.g. Einflüsse verwitterten Kimberlit,
in dem die ersten Diamanten aus primären Vorkommen in Südafrika
gefunden wurden. Den darunter befindlichen nicht verwitterten
Kimberlit, blue ground (engl.: blaues Gestein), erkannte man erst
später als diamantführend.
Schwerkraft,
Wind und Wasser führen die Bruchstücke der Krater weg und lagern
sie oft über große Entfernungen als Sedimente in Flußbetten, Schwemmlandebenen
und auf dem Meeresgrund ab. Während Gestein durch den langsamen
Prozeß der Erosion abgetragen wird, bleiben die viel härteren
Diamanten, die auch durch das sehr lang andauernde Rollen und
Schieben nicht zerrieben werden, unbeschädigt und werden langsam
stromabwärts gespült. Dort sammeln sie sich nach und nach in den
sogenannten Seifenlagerstätten an.
Diese sekundären Vorkommen sind meist ergiebigere, konzentriertere
Lagerstätten als die primären Vorkommen, weil dort schon ein Ausleseprozeß
stattgefunden hat: Das die Diamanten umgebene Gestein, weil weicher
und leichter, wird weiter fortgewaschen, die Diamanten bleiben
aber zurück.
Weltweite
Verteilung der Diamantvorkommen
Einen
Überblick über die weltweiten Diamantvorkommen erhalten Sie hier:
Übersicht.
Historisch
betrachtet, sind Diamantvorkommen in Indien die
ersten gewesen, die ausgebeutet wurden. Von hier stammen auch
die meisten der historischen Diamanten. Die dortigen Hauptvorkommen
sind vorwiegend in den östlichen Landesteilen zu finden. Bis zur
Entdeckung der ersten Diamanten in Brasilien versorgte allein
Indien den Weltdiamantbedarf; man schätzt, daß dort bis zu diesem
Zeitpunkt 30 Millionen Karat Rohdiamanten gefördert worden waren.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden dann die brasilianischen
Diamantvorkommen entdeckt. Diese waren hauptsächlich in der Nähe
von Flüssen anzutreffen (sekundäre Vorkommen). Die dortigen Funde
waren so ergiebig, daß der Handel aus Indien fast völlig zum Erliegen
kam. Die in dieser Zeit aus Brasilien in Europa eintreffenden
Mengen betrugen etwa das zehnfache der indischen Produktion.
Beinahe 150 Jahre war Brasilien der Welt-Hauptlieferant
für die aber auch ständig zunehmende Diamantennachfrage. Nach
1850 erschöpften sich langsam die dortigen Diamantvorräte - der
Handel kam abermals fast zum Erliegen. Aber zum Glück wurden gerade
in dieser Zeit die ersten Funde in Südafrika gemacht
ausführliche Story der ersten Diamantfunde in Südafrika. Diese
waren deshalb so bedeutend, weil sie die ersten primären Diamantvorkommen
waren, die entdeckt wurden (vorher kannte man nur sekundäre),
und weil sie zum einen ausgesprochen ergiebig waren (bereits bis
1880 ließen die südafrikanischen Funde die Rohdiamantproduktion
auf drei Millionen Karat ansteigen), und zum anderen den Grundstein
legten für die noch heute andauernde weltweite Machtstellung des
De Beers-Konzerns. In dieser Zeit erreichte der Diamant einen
Anteil von mehr als 80% des weltweiten Edelsteinumsatzes (deshalb
wurde er auch "König der Edelsteine" genannt). Das barg
natürlich Gefahren für den Preis, so daß besondere wirtschaftspolitische
Maßnahmen notwendig wurden, um die relative Seltenheit des Diamanten
zu erhalten, auch wenn von der Gesamtförderung durchschnittlich
nur ein Viertel für Schmucksteine geeignet waren. Eine zentrale
Verkaufsstelle für den größten Teil der südafrikanischen Rohdiamanten
wurde gegründet, um Angebot und Nachfrage über eine Anpassung
der Fördermenge einander anzugleichen. Der Vorläufer der heutigen
Central Selling Organisation von De Beers war gegründet worden.
Bis zur Gegenwart brachte das 20. Jahrhundert weitere Entdeckungen
afrikanischer Diamantvorkommen (die zur Zeit 13 diamantproduzierenden
Länder Afrikas stehen mit ca. 70% an der Spitze der Diamant-Weltproduktion).
Der Anteil der Diamanten mit Edelsteinqualität ist in Namibia
außergewöhnlich hoch, er beträgt 90-95 % (vorwiegend sekundäre
Vorkommen aus den Pipes von Südafrika). Siehe auch: Beispiel für
Bedeutung der Diamantenproduktion in der Dritten Welt
Mittlerweile hat sich Rußland zu einem der größten
Diamantproduzenten entwickelt. Erst ab 1949 wurden die dortigen
Vorkommen ernstzunehmend abgebaut. Umfangreiche alluviale Vorkommen
in Sibirien, später auch diamantführende Pipes, lassen Rußland
bald an einen der obersten Plätze in der Weltrangliste der Diamantlieferanten
aufsteigen.
Auch China gehört nun zu den bedeutenden Diamantländern.
Die ersten Lagerstätten (vorrangig alluviale) werden ab 1940 entdeckt,
später gelingt dann der große Durchbruch mit der Entdeckung mehrerer
Kimberlitschlote.
Als beinahe spektakulär sind die Vorkommen in Australien
zu nennen: Seit 1986 ist die dortige Argyle-Mine im Nordwesten
des Kontinents in Vollproduktion und 1994 wurden bereits 39 Millionen
Karat gefördert. Das entspricht etwa einem Drittel der Weltproduktion,
der erste Platz. Relativierend muß allerdings angeführt werden,
daß der wertmäßige Anteil kaum ein Zehntel davon beträgt. Denn
nur 5% der Gesamtproduktion sind Diamanten mit guter Edelsteinqualität
(Schmucksteine), 45% mit minderer Schmuckqualität und 50% Industrieware.
In Nordamerika wurden mehrere Funde gemacht, darunter auch
Pipes, aber keiner von großer Bedeutung. Für die Zukunft ist jedoch
in Kanada mit einer großen Diamantproduktion zu rechnen.