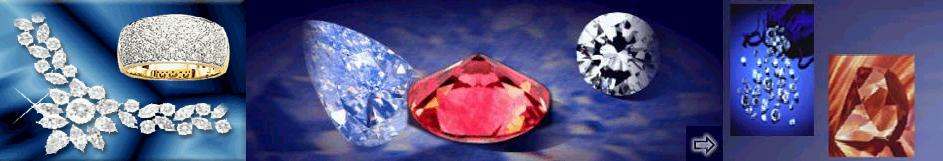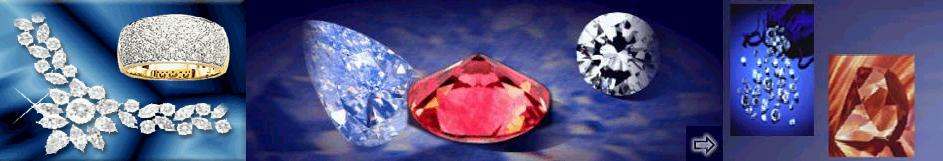| Infos
Materialkunde
Entstehung
Vorkommen
Förderung
Bearbeitung
Graduierung
Historische
Diamanten
Einleitung
Koh-i-Noor
Blaue Hope
Cullinan
Schah
Großmogul
Florentiner
Sancy
Regent
Übersicht
Lehrgänge
Verwendung


Copyright
by
Maisenbacher Diamonds
B.V.B.A.
B-2018
Antwerpen
| |
Historische
Diamanten
- Ein
Beispiel der Bedeutung -
|
Bei dem
an dieser Stelle angeführten Beispiel für die Bedeutung
der Diamanten als Zeichen der Würde der Herrschaftshäuser
entbehrt es nicht der Ironie, daß gerade das aus Hunderten
von Edelsteinen bestehende Schmuckstück, das enger als
jedes andere mit dem Schicksal eines Königshauses verknüpft
ist, nie in Herrscherhände gelangte. Statt dessen wurden
- in der berühmt gewordenen sogenannten "Halsbandaffäre"
- der französische König Ludwig XVI. und seine leichtsinnige
Frau Marie Antoinette unglückliche Opfer eines dreisten
Betrugs, dessen unheilvolle Folgen ihren Weg zur Guillotine
beschleunigten.
Die raffinierte Intrige begann durchaus harmlos in der Regierungszeit
Ludwigs XV., als die Hofjuweliere Charles-Auguste Boehmer und
Paul Bassenge den Entschluß faßten, ein Diamantcollier
anzufertigen, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte. Der
König, dessen waren sie sich absolut sicher, würde
nur allzu gern bereit sein, die Kette für seine Mätresse
Madame Dubarry zu erwerben.
Mit diesem Ziel vor Augen verwendeten die Juweliere mehrere
Jahre darauf, einige der feinsten Diamanten der Welt zusammenzukaufen
und ihr Meisterwerk zu entwerfen und auszuführen. Um das
Projekt zu finanzieren, mußten sie sich hoch verschulden
und sogar ihre Häuser und Werkstätten mit Hypotheken
belasten. Im Jahre 1774, als das Werk seiner Vollendung entgegenging,
durchkreuzte der plötzliche Tod des Königs jäh
ihre Pläne.
Boehmer und Bassenge hatten jetzt eine prachtvolle Halskette
mit 647 sorgfältigst aufeinander abgestimmten Diamanten
ersten Wassers - und keinen Käufer dafür. Natürlich
setzten die Juweliere nun alle ihre Hoffnungen auf den 24jährigen
Ludwig XVI. und seine 23jährige Königin. Der König
war auch wirklich hingerissen von der Kette und wollte sie unbedingt
als Geschenk für Marie Antoinette erwerben, die ihm gerade
ein Kind geboren hatte. Ein passendes Präsent, hätte
man meinen können, für eine Dame, deren Hang zu amourösen
Extravaganzen zum Gesprächsthema des ganzen Kontinents
geworden war. Doch mit einer Selbstlosigkeit, die man ihr gar
nicht zugetraut hätte, wies die Königin die Kette
zurück und schlug (so behaupteten jedenfalls später
ihre Parteigänger) dem König vor, er solle das Geld
lieber für ein neues Kriegsschiff ausgeben.
Jahrelang ließen Boehmer und Bassenge nichts unversucht,
um Marie Antoinette doch noch umzustimmen. Einmal fiel Boehmer
weinend vor der Königin auf die Knie. "Madame', rief er,
ich bin ruiniert, bankrott, entehrt, wenn Sie weiterhin die
Kette zurückweisen. Ich gehe von hier aus geradewegs zum
Fluß und ertränke mich!" Als Marie Antoinette durchblicken
ließ, daß sie dies für keine schlechte Idee
halte, gab Boehmer auf. Die Kette blieb unverkauft.
So war es nur zu verständlich, daß die verzweifelten
Juweliere überglücklich waren, als sie im Jahre 1785
einen vielversprechenden Brief von einer gewissen Jeanne de
Saint-Rémy de Valois de La Motte erhielten, die erst kurz zuvor
in der Pariser Gesellschaft aufgetaucht war, aber gerüchteweise
schon als Vertraute der Königin bezeichnet wurde. Madame
de La Motte ließ die beiden Herren wissen, ein grand
seigneur des Reiches sei am Erwerb der Halskette interessiert
und werde sich in Kürze bei ihnen melden.
In Wirklichkeit war die junge und reizvoll gebaute Madame
de La Motte im Begriff, einen ebenso dreisten wie raffiniert
eingefädelten Schwindel von historischen Dimensionen zu
inszenieren. Als verwaiste Tochter eines heruntergekommenen
Barons, der in einem Pariser Armenhaus gestorben war, hatte
Jeanne als Bettlerin in den Straßen von Paris und später
als unfreiwilliger Zögling eines Internats in Passy einen
stahlharten Überlebenswillen entwickelt. Sie war, nach
den Worten eines Zeitgenossen, "eine ehrgeizige Person ohne
jede Prinzipien, die bei der Verfolgung ihrer Ziele vor nichts
haltmachte; unversehens in diese Ansammlung von Schranzen und
Speichelleckern, Tagedieben und Intriganten geraten, erwies
sie sich als Musterschülerin in der Versailler Schule des
Lasters".
Der hohe Herr, mit dem sie die Juweliere zusammenbringen
wollte, war kein Geringerer als Louis Rend Edouard de Rohan,
Prinz und Kardinal, der bei Marie Antoinette in Ungnade gefallen
war und verzweifelt versuchte, die Gunst der Königin zurückzugewinnen.
Die hübsche Jeanne hatte, offenbar mit Zustimmung ihres
nichtsnutzigen Mannes, den Kardinal verführt, und zwar
in mehrfacher Hinsicht. Während sie mit ihm das Bett teilte,
hatte sie ihn nach Kräften zu überzeugen versucht,
sie sei eine enge Freundin der Königin und könne sich
bei ihr für seine Rehabilitierung verwenden.
Er glaubte ihr, und sie besiegelte sein Schicksal mit einem
Gaunerstück von unglaublicher Unverfrorenheit. In der Pariser
Unterwelt machte sie mit Hilfe ihres Mannes eine Prostituierte
ausfindig, die Marie Antoinette ähnlich sah, und engagierte
sie zu dem Zweck, "der Königin einen kleinen Gefallen zu
tun". Die Frau erklärte sich bereit, mit den de La Mottes
nach Versailles zu fahren, ein Kleid anzuziehen, das sie ihr
besorgen würden, und sich mit verschleiertem Gesicht in
einem Park hinter dem Palast aufzustellen. So ausgerüstet,
würde sie auf einen "Mann von sehr hohem Range" warten
- keinen anderen als Kardinal de Rohan, der vor Freude außer
sich war, als Jeanne ihm sagte, Marie Antoinette habe sich zu
einer geheimen Zusammenkunft im Schutz der Dunkelheit bereit
erklärt.
Die Begegnung dauerte nur ein paar Augenblicke. Die falsche
Königin überreichte Rohan einfach eine Rose und sprach
dazu die rätselhaften Worte: "Sie wissen, was das bedeutet."
Als der Prinz-Kardinal sich ihr daraufhin zu Füßen
warf, verschwand sie eilig in der Dunkelheit.
Als Jeanne de La Motte den Kardinal kurze Zeit später
fragte, ob er beim Kauf der fabelhaften Halskette der Herren
Boehmer und Bassenge für die Königin als Mittelsmann
fungieren wolle, stimmte der betörte Rohan begeistert zu.
Der Kardinal erwies sich als guter Geschäftsmann; er
handelte bei den Juwelieren nicht nur einen kleinen Preisnachlaß
- auf 1 600 000 Livres - aus, sondern brachte sie auch dazu,
ihm die Kette schon volle sechs Monate vor der Fälligkeit
der ersten Rate zu übergeben. Der Kardinal seinerseits
händigte die Diamanten unverzüglich Madame de La Motte
aus, damit diese sie - wie er meinte - seiner teuren Marie Antoinette
überbringen konnte.
Jeanne und ihr Mann gingen sofort daran, die Kette auseinanderzunehmen
und die Beute zu teilen. Während er so klug war, sich nach
London abzusetzen, blieb Jeanne, leichtsinnig wie sie war, in
Paris. Sie ließ einige der Diamanten in Armbänder,
Anhänger und Ringe zum eigenen Gebrauch einsetzen, kaufte
sich vom Erlös der übrigen Steine kostspielige Kleider
und teure Einrichtungsgegenstände für ein neues Haus,
sammelte erlesenes mechanisches Spielzeug und leistete sich
eine Kutsche, die auch der Königin Ehre gemacht hätte.
Unterdessen wartete Kardinal de Rohan vergeblich darauf,
daß Marie Antoinette ihm durch irgendeine öffentliche
Geste ihre Dankbarkeit bezeigen möge. Noch mehr aber bedrückte
ihn, daß die Juweliere schon bald ihr Geld wollten. Obwohl
Jeanne de La Motte alle Hebel in Bewegung setzte, um den Tag
der Abrechnung hinauszuschieben, begab sich Boehmer schließlich
zu Marie Antoinette, um von ihr die Bezahlung zu fordern.
Damit war der Schwindel aufgeflogen, und Ludwig XVI. war,
wie er in einem Brief schrieb, "voller berechtigtem Zorn über
so unerhörte Dreistigkeit, solch einen tollkühnen
Versuch, mit einem erhabenen Namen Schindluder zu treiben, eine
so flagrante Mißachtung des Respekts, den jedermann der
königlichen Majestät schuldig ist". Obwohl es durchaus
in seiner Macht gestanden hätte, den Skandal zu vertuschen
und die Schuldigen persönlich zur Rechenschaft zu ziehen,
gestand der König Jeanne und Rohan eine öffentliche
Gerichtsverhandlung zu.
Das war ein Fehler. Jeanne de La Motte nutzte die Gelegenheit
eines öffentlichen Auftritts, um einen Schwall verleumderischer
Behauptungen loszulassen und während des ganzen Prozesses
zu beteuern, sie sei das Opfer einer habgierigen und undankbaren
Königin geworden. Die Stimmung im Lande war so, daß
viele ihr glaubten. Das Volk murrte schon seit langem über
das korrupte Regime und die Königin, die als "Dirne von
Versailles" verschrien war.
Öl in das Feuer, das eines Tages Marie Antoinette verschlingen
sollte, waren die Worte von Rohans Richtern. Der Kardinal war
der Majestätsbeleidigung angeklagt worden, weil er angenommen
hatte, die Königin von Frankreich würde sich mit ihm
zu einem nächtlichen Rendezvous in den Gärten von
Versailles verabreden. Dagegen die Richter: "Wir können
an dieser Annahme des Kardinals de Rohan nichts Strafwürdiges
finden. In Anbetracht Ihrer Allerchristlichsten Majestät
Reputation für Frivolität und Unbesonnenheit und angesichts
ihrer zahlreichen männlichen und weiblichen Günstlinge
von zweifelhafter Reputation halten wir es für durchaus
plausibel, daß der Kardinal sich einer solchen Vermutung
hingab."
Jeanne de La Motte jedoch wurde verurteilt: Sie sei "auszupeitschen,
nackt, und mit Stöcken zu schlagen"; außerdem sei
sie an der Schulter mit dem Buchstaben V (für voleuse,
Diebin) zu brandmarken und für den Rest ihres Lebens in
die Besserungsanstalt in Salpêtrière einzuweisen. Schon nach
einem Jahr verhalfen jedoch unbekannte Gönner Jeanne de
La Motte zur Flucht. Sie floh nach London, wo ihr undankbarer
Mann jedoch nichts mehr von ihr und ihren Machenschaften wissen
wollte. Vier Jahre später fand Madame de La Motte den Tod,
als sie - nicht ohne fremdes Zutun, wie manche behaupteten -
aus dem dritten Stock eines Londoner Gebäudes stürzte.
Ludwig XVI. und Marie Antoinette erholten sich nie mehr
von den Folgen des Skandals, dessen ahnungslose und unschuldige
Opfer sie waren. Und obwohl das Volk von Paris zweifellos in
jedem Fall auf die Barrikaden gestiegen wäre, wurde der
Gang der revolutionären Ereignisse sicherlich durch Jeanne
de La Mottes großen Schwindel beschleunigt. So bezeichnete
denn auch kein Geringerer als Honoré Gabriel de Mirabeau, selbst
ein Herold der Auflehnung, die Halsbandaffäre als "ein
Vorspiel zur Revolution".
Vielleicht mit Ausnahme von 22 Steinen, die später
in einer Halskette im Besitz des Herzogs von Sutherland auftauchten
und möglicherweise aus der Halskette der Königin stammten,
blieben die Diamanten, die so liebevoll von den beiden französischen
Juwelieren zusammengetragen worden waren, für immer verschwunden.
Man hat jedoch geschätzt, daß die spektakuläre
Sammlung heute mindestens acht Millionen Dollar erzielen würde.
Ein solcher Preis fände freilich seine Rechtfertigung nicht
allein im tatsächlichen, materiellen Wert der Steine, sondern
auch in den Geschichten und Gerüchten, die sie umgeben.
aus:
"Der Planet Erde - Edelsteine", Paul O'Neil, Time-Life Bücher,
Amsterdam, 1984
|
|

|