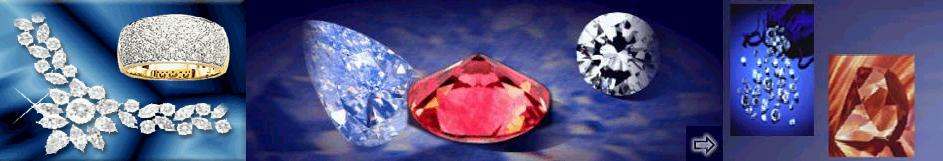| Infos
Materialkunde
Entstehung
Vorkommen
Förderung
Bearbeitung
Graduierung
Historische
Diamanten
Einleitung
Koh-i-Noor
Blaue Hope
Cullinan
Schah
Großmogul
Florentiner
Sancy
Regent
Übersicht
Lehrgänge
Verwendung


Copyright
by
Maisenbacher Diamonds
B.V.B.A.
B-2018
Antwerpen
| |
In
den Anfängen der Diamantsuche schürften die Männer in den Flüssen
und Bächen. Dort waren die ersten Steine immer aufgetaucht. Erst
durch Zufall kam man dem wahren Ursprung dieser Kostbarkeiten auf
die Spur.
Ungefähr zu der Zeit, als noch alle neuen Schatzsucher sich
den Scharen der alten Prospektoren anschlossen und an den Ufern
des Vaal und Oranje Schlamm siebten, fand ein Mann, von dem nur
der Name Bam überliefert ist, 100 Kilometer entfernt von der nächsten
Schürfstätte am Fluß, einen weiteren Diamanten. Aus Erfahrung wußten
die Prospektoren - von denen einige Veteranen des kalifornischen
Goldrausches waren -, daß Kostbarkeiten wie Gold und Edelsteine
in Flußbetten zu finden waren. Erst später setzte sich die Erkenntnis
durch, daß die Steine nicht an den Flußufern entstanden, sondern
vorn Wasser dorthin transportiert worden waren. Bams Entdeckung
war also keineswegs eine kuriose Ausnahme, sondern vielmehr ein
wichtiger Schritt zur Auffindung der Primär-Lagerstätten aller südafrikanischen
Diamanten.
Diejenigen, die Bams Hinweis folgten und sich tiefer ins
Land hinein begaben, um dort zu schürfen, blieben eine Zeitlang
so gut wie allein. Als dann jedoch in diesen Gegenden immer mehr
Steine gefunden wurden, erhielten auch die anderen Prospektoren
rasch Kenntnis davon und strömten in hellen Scharen in das Gebiet.
Die Schatzsucher wußten aber immer noch nicht, daß sie jetzt ganz
in der Nähe des Gebiets schürften, in dem viele der Diamanten, die
längs des Oranje und Vaal gefunden wurden, wahrscheinlich zum erstenmal
an die Erdoberfläche gekommen waren.
Im Jahre 1871 steckte ein Mann namens Fleetwood Rawstorne
einen Claim auf einer Farm in diesem vielversprechenden, im Landesinnern
gelegenen Gebiet ab, zwischen Oranje und Vaal und östlich ihres
Zusammenflusses. Rawstorne hatte kein Glück. Er verspielte seinen
ersten Claim und fand später auf einem zweiten kaum mehr als einzelne
zweikarätige Diamanten. Die beiden Brüder, denen die Farm gehörte,
waren ebenfalls Pechvögel, aber aus ganz anderen Gründen. Als Buren
- Nachfahren der ersten holländischen Siedler in Südafrika - interessierten
sie sich überhaupt nicht für Edelsteine und waren entsetzt über
die Prospektoren, die in Schwärmen einfielen und in ihrer fieberhaften
Suche nach Diamanten die Erde aufwühlten. Um sich in dieser hoffnungslosen
Lage einigermaßen schadlos zu halten, verkauften die Brüder die
Farm (die sie elf Jahre zuvor für 50 Pfund erworben hatten) für
6300 Pfund an eine Minengesellschaft und zogen weiter, um anderswo
Ruhe und Frieden zu finden. Damit verzichteten Johannes und Diedrich
de Beer unwissentlich auf zwei sagenhaft reiche Diamantenlagerstätten,
von denen eine - diejenige, an der Fleetwood Rawstorne seine kärglichen
Funde gemacht hatte - die berühmte Kimberley-Mine werden sollte;
genausowenig ahnten sie, daß ihr Familienname weltberühmt werden
sollte.
Ungefähr zu dieser Zeit auch trat ein neuer, für die Zukunft
der Diamanten außerordentlich wichtiger Mensch in das Geschehen
ein: Cecil Rhodes. Aus England kommend suchte dieser damals 18 jährige
seinen hier schürfenden Bruder auf, um es ihm gleichzutun; bewirkte
aber weit mehr als jeder andere vor und nach ihm. Er schuf die Voraussetzungen
und legte das Fundament für den Erfolg des Unternehmens, das heute
weltweit jeder in Verbindung mit Diamanten nennt: De Beers. Aber
dazu später in den Abschnitten "Der Diamanthandel" mehr.
Die Diamantensucher, die von den Schürfstellen an den Ufern
des Oranje und des Vaal abwanderten, steckten ihre Claims ab und
begannen auf ganz ähnliche Weise zu schürfen wie an den Flüssen.
Der Hauptunterschied war, daß es hier kein Wasser zum Auswaschen
der Erde aus dem Kies gab. Die Minen in diesem Gebiet wurden deshalb
als dry diggings (trockene Schürfstellen) bezeichnet. Wie Cecil
Rhodes später einmal bemerkte, sahen die Minen auf den ersten Blick
aus "wie zahllose Ameisenhaufen, auf denen es von schwarzen Ameisen
wimmelte, nur daß die Ameisen Menschen waren".
Die Arbeits- und Lebensbedingungen in dem neu entstandenen
Ort Kimberley und seiner Umgebung waren noch chaotischer und primitiver
als in den Camps an den Flüssen. Ein staubiges Durcheinander von
Zelten und Wellblechhütten beherbergte Konzessionsbüros, Gesetzesvertretungen,
Banken, Diamantenläden, Kneipen, Bordelle, Spielhöllen und die eine
oder andere Kirche. Das bunt zusammengewürfelte Volk der Diamantensucher
war ständig in Bewegung, denn jeder sagte sich, daß ihn schon fünf
Minuten Nichtstun um einen wertvollen Stein bringen konnten. Lebensmittel
und Feuerholz wurden von den umliegenden Farmen geliefert, aber
Industrieprodukte mußten mit Pferdewagen von der Küste über Land
transportiert werden.
Zu Beginn der Schürfarbeiten in der Kimberley-Pipe hatten
die vielen hundert einzelnen Prospektoren insoweit zusammengearbeitet,
als sie an den Rändern ihrer Schächte die Erde unangetastet ließen.
So war dafür gesorgt, daß die einzelnen Schächte voneinander getrennt
blieben und zwischen ihnen Erdmauern stehenblieben, auf denen man
sich fortbewegen konnte. Es war vereinbart, daß diese Zwischenwände
jeweils erst dann abgebaut und ausgebeutet werden sollten, wenn
es nötig wurde, die Straßen insgesamt tiefer zu legen.
Es stellte sich aber heraus, daß die einzelnen Minenbesitzer
ihre Schächte unterschiedlich schnell in die Tiefe trieben, so daß
der richtige Zeitpunkt zum Einreißen der Zwischenwände oft verpaßt
wurde. Die Zwischenwände bröckelten daher oft ab und stürzten in
die Schächte, wobei sie manchmal auch Arbeiter unter sich begruben.
Nach einer Besichtigung der Kimberley-Pipe schrieb der englische
Schriftsteller Anthony Trollope, es sei, "als hätte ein Architekt
von diabolischem Genie ein Haus mit 500 Zimmern entworfen, von denen
keines im gleichen Geschoß sein sollte wie ein anderes und die weder
durch Treppen zugänglich noch mit Türen oder Fenstern versehen sein
sollten".
Hinzu kam, daß die Oberfläche der Mine bei allen Höhenunterschieden
zwischen den einzelnen Schächten sich insgesamt immer weiter absenkte.
Die in das tiefer werdende Loch hinunterführenden Straßen, selbst
solche, die breit und gut befestigt waren, wurden für einen sicheren
Transport zu steil. So sah man sich schon bald gezwungen, Drahtseile
vom Rand des Loches in jeden einzelnen Schacht hinunter zu legen;
an diesen Drahtseilen liefen offene Fahrkörbe, in denen die Arbeiter
und der Kimberlit transportiert wurden. Es dauerte nicht lange,
und die ganze Pipe war von einem chaotischen Gewirr kreuz und quer
verlaufender, rostender Kabel durchzogen, die einander im Weg waren.
Außerdem hatten die Minenbesitzer mit schweren Überschwemmungen
zu kämpfen, die durch die zwar seltenen, dann aber um so heftigeren
Regenfälle und durch einsickerndes Grundwasser verursacht wurden.
Trotz der gewaltigen Mengen von Diamanten, die aus Südafrika
auf den Weltmarkt gelangten - von 1872 bis 1874 waren es über eine
Million Karat -, blieben die Preise eine Zeitlang stabil. Eine weltweite
Finanzkrise im Jahre 1873 löste jedoch einen zwar langsamen, aber
stetigen Preisverfall bei Diamanten aus, und dies ausgerechnet zu
einer Zeit, als die Gewinnung der Edelsteine für die Minenbesitzer
immer schwieriger und kostspieliger wurde. Die ersten Prospektoren
in Kimberley fanden ihre Steine im yellow ground, verwittertem Gestein,
das später den Namen Kimberlit erhielt. Als sie jedoch den unteren
Rand des weichen yellow ground erreichten und auf den darunterliegenden
blue ground stießen, glaubten viele, ihre Minen seien erschöpft.
Rhodes hingegen, der sich von den wenigen Geologen in Südafrika
beraten ließ, neigte zu der Vermutung, daß der blue ground genauso
reich an Diamanten sein müsse wie der yellow ground.
Wie sich bald herausstellen sollte, hatte er damit recht,
und die Geologen fanden auch die Erklärung dafür. Der yellow ground
war tatsächlich nur die oberste Schicht des diamantführenden Gesteins
in den tiefen, trichterförmigen Pipes, die durch vulkanische Tätigkeit
entstanden waren. Beim blue ground handelte es sich einfach um Kimberlit,
der noch nicht durch Verwitterung zerkleinert oder verfärbt war.
Rhodes erkannte auch, daß die hier entstandenen Minen, die Kimberley-,
die De-Beers- und andere Pipes, nicht auf unbegrenzte Zeit von der
Erdoberfläche aus, also im Tagebau, ausgebeutet werden konnten.
Und so kam es, daß man kurze Zeit später zum Untertagebau überging.
Von 1871 bis 1908 wurde die Kimberley-Pipe ohne jede Maschine
abgebaut; nachdem man zum Untertagebau übergegangen war, wurde sie
1914 wegen zu geringer Ergiebigkeit stillgelegt. In dieser Zeit
war das größte je von Menschenhand gegrabene Loch entstanden: Das
"Big Hole" hat an der Oberfläche einen Durchmesser von 460 m und
eine Schachttiefe von 1070 m, und ist heute bis zur Hälfte mit Wasser
gefüllt. Hier wurden insgesamt 14,5 Mio. Karat Diamanten gefördert;
das entspricht einem Gewicht von 2900 kg.
|
|

The
Big Hole in Kimberley

Das
Fördergut mußte mit Seilsystemen nach oben befördert werden

Am
Rand standen riesige Winden

heute
ist nur noch ein riesiges Loch übriggeblieben

Ein
1070 m tiefer Krater, zur Hälfte mit Wasser gefüllt
|